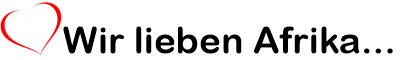Der Tag, der in den Vorhof der Hölle führen sollte – Teil 1
Da wir von Nouakchott aus in einem Tag bis zur Grenze bei Diama (Senegal) fahren wollten, erlaube ich mir, zuerst noch ein paar Worte über diese Millionenstadt zu verlieren.
Und bevor ich über den Grenzübergang schreibe, muss ich kurz auf den Ausdruck „Vorhof der Hölle“ eingehen.
In vielen Foren und Reiseberichten liest man, dass die beiden Grenzübergänge zwischen Mauretanien und Senegal zu den schlimmsten in ganz Afrika gehören sollen. Es ist von Willkür, von undurchsichtigen Abläufen und von Korruption im großen Stil die Rede. Reisende berichten, dass der Grenzübergang Rosso die „Hölle“ sei – und der von Diama der „Vorhof der Hölle“.
Wie viel Wahrheit in diesen Erzählungen steckt, werden wir bald selbst erleben.
Doch zuerst ein paar Gedanken zu Nouakchott, der Hauptstadt Mauretaniens.
Mit ihrer kurzen Geschichte von gerade einmal 67 Jahren hat sich diese Stadt in einer atemberaubenden Geschwindigkeit zu einer Millionenmetropole entwickelt.
Die strategisch günstige Lage am Atlantischen Ozean im Süden des Landes war 1958 der Grund, warum man hier – an der Stelle eines kleinen Dorfes mit kaum 500 Einwohnern – eine Hauptstadt für das bald unabhängige Land errichtete.
Ein kurzer Abriss des rasanten Wachstums:
In den 1960er Jahren war Nouakchott kaum mehr als ein Fischerdorf. 1969 lebten hier rund 20 000 Menschen. In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Stadt explosionsartig: 1988 zählte man bereits etwa 393 000 Einwohner, 2013 fast eine Million – und für 2025 wird die Bevölkerung auf über 1,6 Millionen geschätzt.
Und genau das spürt man, wenn man heute durch die Straßen fährt: Überall wird gebaut, improvisiert, gegraben, gehämmert. Doch die Infrastruktur kann mit diesem Tempo längst nicht mehr mithalten.
Die Abfallentsorgung funktioniert nur teilweise, viele Straßen sind löchrig oder unbefestigt. Jeder scheint irgendwie für sich zu kämpfen – ums Überleben, ums Dasein, ums Weiterkommen.
Es ist beeindruckend, wie viel Tatkraft und Überlebenswille hier sichtbar wird, und gleichzeitig berührend, wie viele Schicksale sich dahinter verbergen.
Ein Bild hat sich mir besonders eingebrannt:
Ein Mann mit schwerer Behinderung, der vor einer Ampel am Boden kriecht – in der einen Hand eine leere Dose, am Körper eine gelbe Warnweste. Er bewegt sich mühsam zwischen den Autos, die hupend an ihm vorbeiziehen, und hofft auf ein paar Münzen.
Ich habe auf unseren Reisen schon vieles gesehen, aber solche Bilder treffen mich jedes Mal tief. Sie rufen mir ins Bewusstsein, wie dankbar ich bin, in der Schweiz geboren worden zu sein.
Wie klein und nichtig erscheinen einem da all die Sorgen, die uns zuhause so wichtig vorkommen.
Eigentlich wollte ich über unsere Fahrt schreiben – über jenen Tag, der uns in den „Vorhof der Hölle“ führen sollte.
Doch wenn ich ehrlich bin, verblassen diese Grenzgeschichten, das Gerangel um Stempel und Papiere, angesichts dessen, was einem hier auf offener Straße begegnet: das wahre Leben, roh, direkt und ungeschminkt.
Auf dem Weg in den Vorhof der Hölle
Nach dem Auffüllen unserer Dieseltanks mit dem aus Marokko mitgebrachten Treibstoff begann der Tag mit einem feinen, aber hartnäckigen Dieselgeruch. Beim Umfüllen der Kanister war wohl der eine oder andere Tropfen danebengegangen – nichts Dramatisches, aber genug, um uns den Geruch für den Rest des Tages zu sichern. Diesel hat eben seinen ganz eigenen Charakter.
Doch die Nase sollte sich ohnehin noch an viele andere Düfte gewöhnen.
Am Hafen lag schwer der Geruch von frisch verarbeitetem Fisch in der Luft, später zog Rauch über die Straße, wo alte Lastwagen mit schwarzen Abgaswolken ihre eigene Tarnung schufen. Dann wieder roch es nach Chemie – süßlich, scharf, fast beissend – und schließlich nach verbranntem Müll.
Dieser Geruch löste in mir eine seltsame Erinnerung aus: Vor über sechzig Jahren, in unserer Kindheit in der Schweiz, war es ganz normal, dass man die Abfälle in der „Kacheligrube“ verbrannte und die Reste anschließend fein säuberlich mit Erde bedeckte. Es war eine andere Zeit, aber der Geruch ist geblieben – eine Mischung aus Nostalgie und Kopfschütteln.
Die Straße Richtung Süden war überraschend gut ausgebaut, und die Landschaft wurde zunehmend grüner. Nach den endlosen Sand- und Staubtönen der letzten Wochen war das Grün eine Wohltat für die Augen – fast wie ein Stück Heimat in weiter Ferne.
Zwischen den Dünen blitzten plötzlich grüne Streifen hervor, kleine Felder, Büsche, Bäume – ein faszinierender Kontrast von Gold und Smaragd. Es sind solche Bilder, die die langen Fahrten lebendig machen.
Nach etwa zweihundert Kilometern Asphalt bogen wir rechts Richtung Diama ab.
Wie abgeschnitten endete die breite Straße, und es begann eine schmale Teerstraße – noch gut befahrbar, aber mit den ersten Schlaglöchern, die ahnen ließen, was noch kommen würde.
Dafür gab es eine andere Überraschung: Affen!
Plötzlich huschten sie über die Straße, verschwanden im Gebüsch, tauchten kurz wieder auf – ein flüchtiger, aber intensiver Moment, der uns zum Lächeln brachte. Solche Begegnungen sind kurz, aber sie brennen sich tief ein, weil sie uns zeigen, dass wir wirklich in einer anderen Welt angekommen sind.
Doch bald war auch diese Straße zu Ende, und vor uns lag eine Piste von etwa 55 Kilometern, die uns durch den Nationalpark Banc d’Arguin entlang des Senegal-Flusses führen sollte.
Der Weg war schlecht – stellenweise nur 15 km/h möglich –, aber die Landschaft entschädigte für alles: Warzenschweine kreuzten unseren Weg, bunte Vögel stiegen auf, Reiher, Ibisse, Störche, und irgendwo in der Ferne, so sagten uns andere Reisende, sollen sogar Krokodile leben.
Etwa nach 35 Kilometern endete die Idylle abrupt:
Vor uns blockierten zwei Lastwagen die gesamte Piste.
Kaum zu glauben, dass 40-Tonnen-Fahrzeuge diese Route überhaupt wählen!
Der erste hatte einen Reifen verloren und steckte fest. Der zweite hatte offenbar versucht, sich am havarierten Laster vorbeizudrängen – und war dabei in eine tiefe Rinne geraten. Das Fahrzeug hing schief, gefährlich geneigt, die Räder drehten nutzlos durch. Ein weiterer Zentimeter – und er wäre gekippt.
Wie sollten wir da vorbeikommen?
Rechts fiel der Weg gut zwei Meter steil ab – ein Böschungswinkel, der uns mit unseren schweren Fahrzeugen unweigerlich zum Umkippen gebracht hätte.
Einige Geländewagen ohne Aufbau wagten sich an der Seite vorbei, doch selbst bei ihnen hielten wir den Atem an: Manchmal stand nur noch ein Rad in der Luft.
Die blockierte Piste
Nun standen wir da – die Grenze nur noch fünfzehn Kilometer entfernt – und vor uns zwei festgefahrene Lastwagen.
An ein Weiterkommen war nicht zu denken. Also hieß es: Strategie überdenken.
Nach einigem Hin und Her entschieden wir uns zu warten.
Man versicherte uns, dass die Laster „bald“, also in etwa vier bis fünf Stunden, wieder flottgemacht würden und der Weg dann frei sei.
Wie das geschehen sollte, durften wir nach rund drei Stunden Warten selbst erleben.
Plötzlich tauchte ein Fahrzeug mit etwa zwanzig Männern auf – Arbeiter, das sah man sofort – und zwei besser gekleideten Männern, die offenbar das Kommando führten.
Der Plan: Der vordere Laster sollte teilweise ausgeladen werden, um ihn leichter zu machen.
Zuerst kamen riesige Säcke mit Kleidung zum Vorschein, die eilig auf den Boden geworfen und abtransportiert wurden.
Dann erschienen 200-Liter-Fässer mit Chemikalien – schwer, unhandlich und gefährlich.
Die Männer wuchteten sie zu zweit oder zu dritt von einem Lastwagen auf den nächsten.
Ich frage mich heute noch, wie sie das geschafft haben.
Man hörte Anfeuerungsrufe, fast wie auf einem Sportplatz, um sich gegenseitig Mut und Kraft zu geben.
Solche Arbeitsweisen wären in der Schweiz wohl schon allein wegen der SUVA unvorstellbar – aber hier fragt niemand, wie die Körper dieser Männer mit sechzig Jahren aussehen werden.
Dann ging es weiter: ganze Fensterrahmen wurden ausgeladen – etwa zwei mal zweieinhalb Meter groß.
Leider waren fast alle Scheiben zerbrochen, und bald lag ein Meer aus Glasscherben auf der Piste.
Trotzdem arbeiteten sie unbeirrt weiter, barfuß oder in Sandalen, mit bloßen Händen.
Als der Laster etwa zur Hälfte entladen war, entschied der Vorarbeiter, dass er sich nun selbst befreien könne.
Erster Versuch – nein.
Zweiter Versuch – wieder nein.
Also wurde Erde unter den Reifen abgeflacht, Sandsäcke wurden herbeigeschleppt, um die tiefen Rinnen etwas aufzufüllen.
Noch einmal Schwung holen – der Motor heulte auf – ein dritter Versuch – wieder festgefahren.
Noch mehr Sandsäcke, noch mehr Geschrei, dann der vierte Versuch … und plötzlich, fast wie ein Wunder, befreite sich der Laster selbst aus seiner misslichen Lage.
Mir fiel bei diesem Anblick fast das Herz in die Hose.
Ich war sicher, dass er kippen würde – aber er blieb tatsächlich stehen.
Alles ging gut.
Man versprach uns, den Weg nun freizuräumen, und wir könnten „bald“ passieren.
Doch der Nachmittag wurde langsam zum Abend.
Zusätzlich zu den beiden Lastern hatte sich noch ein Personenwagen dazugesellt, dem der Sprit ausgegangen war.
Er hatte versucht, unten durchzufahren, doch durch die Schräglage des Tanks zog der Motor nur noch Luft.
Weiterkommen? Keine Chance.
Also half ich ihm mit meiner eisernen Reserve von20 Litern Diesel aus.
Natürlich hatte er kein Geld, versprach aber, mir das Geld in Saint-Louis, an der Zebrabar, zurückzugeben.
Wer weiß, wie das Leben spielt …
Ankunft im Dunkeln
Als die Dämmerung einbrach, konnten wir endlich passieren.
Langsam schob sich unser Fahrzeug an den beiden blockierten Lastwagen vorbei – Millimeterarbeit, Herzklopfen inklusive. Danach rollten wir weiter, begleitet vom letzten roten Schimmer des Himmels, der sich bald in völlige Dunkelheit verwandelte.
Ich entschied, dass wir noch rund zehn Kilometer fahren würden, bis zur kleinen Station des Nationalparks. Die Strecke zog sich, Schlagloch um Schlagloch, Staub und Nachtgeräusche ringsum.
Nach etwa 45 Minuten tauchten endlich ein paar Lichtpunkte auf – das Gebäude der Parkstation, schlicht, aber in diesem Moment wirkte es fast wie eine Oase.
Der Tag war lang, anstrengend und voller Eindrücke.
Wir waren müde, aber zufrieden. Der „Vorhof zur Hölle“, von dem so viele Reisende gesprochen hatten, lag wohl schon hinter uns.
Wie wir schließlich die Grenze passierten – das erzähle ich in einer weiteren kleinen Geschichte: Teil 2.