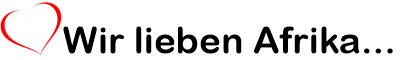Wenn das Meer nicht mehr satt macht – Begegnung bei den Solent Villas
Ort: Solent Villas Resort, Ghana GPS: 5.30265, -0.72370
Der Morgen beginnt am Strand. Es ist diese besondere Zeit kurz nach Sonnenaufgang, die ich mit Christine und «Adia» am meisten lieben. Barfuß im Sand zu laufen, hat für uns schon oft unerwartete Begegnungen bereitgehalten, Momente, die uns zum Staunen brachten. Für Adia sind diese Spaziergänge Freiheit pur; meistens ohne Leine kann sie den Strand untersuchen, ihre Nase tief in die Geschichten stecken, die das Meer an gespült hat.
Leider erzählt der Strand nicht nur von Muscheln und Krabben. Adias Nase findet immer wieder Zeugnisse unserer modernen Zeit: PET-Flaschen, einzelne Schuhe, Verpackungen, Stoffreste und verlorene Fetzen von Fischernetzen. Dieser „Wohlstandsmüll“ ist eines der sichtbarsten Probleme hier, eine bunte, traurige Spur entlang der Küste Westafrikas.
Doch heute Morgen verblasst der Müll vor einer anderen Szenerie. Wir treffen auf eine Gruppe von Männern, die Schwerstarbeit verrichten. Es sind Fischer, die hier seit Jahrhunderten ihr Überleben sichern. Für uns Außenstehende wirkt das Bild fast romantisch: Die kraftvollen Bewegungen, das Meer im Hintergrund, die Gemeinschaft.
Spontan entscheiden wir uns, nicht nur Zuschauer zu sein. Wir reihen uns in die Ziehkolonne ein. Ich will spüren, was es heißt, sich in dieser Gemeinschaft nützlich zu machen, um am Abend essen zu können. Sofort merke ich: Es ist kein Spiel. Es ist pure Kraftanstrengung.
Wir sind Teil der „Beach Seine“-Methode, der traditionellen Strandwadenfischerei. Stunden zuvor war eine Piroge – ein langes, aus einem einzigen Wawa-Baumstamm gehauenes Boot – in einem weiten Bogen aufs Meer hinausgefahren, um das Netz auszulegen. Nun stehen wir hier, zwei Mannschaften, oft 15 bis 25 Personen, und ziehen die Enden langsam wieder an Land.
Was mich fasziniert, ist der Rhythmus. Die Männer singen „Shanties“, rhythmische Gesänge, die den Takt vorgeben. Hau-Ruck. Nur wenn alle gleichzeitig ziehen, bewegt sich die schwere Last durch die Brandung. Es ist ein Gefühl der absoluten Verbundenheit – man ist ein kleines Rädchen in einer jahrhundertealten Maschine aus Muskelkraft und Willen.
Als das Netz endlich den Strand erreicht, stehen alle erwartungsvoll davor. Ich sehe die Dankbarkeit in den Gesichtern, wohl ein stilles Gebet an ihren Gott oder den Meeresgott Bosompo, dass das Meer gibt, was man zum Leben braucht. Doch als ich in das Netz blicke, mischt sich bei mir Ernüchterung ein. Der Ertrag wirkt spärlich für die immense Kraft, die Dutzende Männer über Stunden investiert haben. Zwischen den wenigen silbernen Leibern von Sardinellen und Makrelen blitzt wieder der Plastikmüll hervor.
Zufrieden, geholfen zu haben, aber nachdenklich gehen wir zurück zum Auto. Das Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag lässt mich nicht los. Wieder im Auto, beginne ich zu recherchieren, um zu verstehen, was wir da gerade erlebt haben. Und plötzlich weicht das romantische Bild einer harten Realität mit klaren Strukturen und ernsten Bedrohungen.
Ich lerne, dass das, was wie ein einfaches Handwerk aussieht, eine straffe Organisation ist. Die Fischer gehören meist zum Volk der Fante. Ihre Boote sind heilige Kunstwerke, oft verziert mit Sprüchen wie „Sea Never Dry“ – ein Symbol der Hoffnung, das heute fast zynisch wirkt. Sie folgen dem „Chief Fisherman“, dem Apofohene, der am Strand das Sagen hat.
Doch sobald der Fang an Land ist, ändert sich die Machtdynamik. Jetzt übernehmen die Frauen. Die Konkohemaa, die Fischkönigin, bestimmt den Preis. Ohne diese „Fish Mamas“, die den Handel organisieren und Kredite vergeben, würde hier nichts funktionieren.
Aber warum waren die Netze so leer? Meine Recherche fördert einen Begriff zutage, der wie ein dunkler Schatten über der Küste liegt: „Saiko“.
Während wir am Strand zogen, spielten sich draußen auf dem Meer illegale Dramen ab. Ausländische Industrietrawler fischen in Zonen, die eigentlich den handwerklichen Fischern gehören. Sie fangen alles weg, frieren den Fisch noch an Bord zu Blöcken und verkaufen ihn auf hoher See illegal an Zwischenhändler. Was sie tun, ist Raubbau: Ihre Netze sind so fein, dass sie auch die Jungfische fangen. Der „Nachwuchs“ fehlt.
Den Männern am Strand, mit denen ich Seite an Seite gezogen habe, wird der Fisch buchstäblich vor der Nase weggefangen. Wenn sie am Dienstag, ihrem heiligen Ruhetag, nicht fischen, um dem Meer Erholung zu gönnen, jagen draußen die Trawler weiter.
Wenn ich heute Abend auf das Meer hinausblicke, sehe ich die Szene vom Morgen mit anderen Augen. Es war nicht nur ein romantischer Ausflug mit Adia. Es war ein Blick auf einen Überlebenskampf. Die Fante-Fischer kämpfen nicht nur gegen die Wellen und den Müll, sondern gegen eine unsichtbare Industrie, die ihre Netze leert, bevor sie überhaupt ausgeworfen werden. Das „Sea Never Dry“ auf ihren Booten ist heute mehr Hoffnung als Gewissheit.