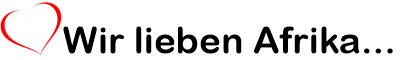Cabinda – Öl, Licht und die leisen Fragen
Cabinda ist eine Enklave. Eingeklemmt zwischen zwei Kongo-Ländern, politisch abgetrennt, geografisch nah – und doch eine eigene Welt. Eine Küste, an der das Meer nachts nicht dunkel wird. Weit draußen stehen sie, die Bohrplattformen. Auf dem Wasser, auf dem Land. Stahlgerüste im Ozean, aus denen Flammen schlagen, als würde die Erde selbst atmen. Gasfackeln, die den Horizont erhellen, lange bevor man sie erreicht.
Solche Bilder begleiten uns nicht nur hier. Auch im Kongo haben wir sie gesehen. Immer wieder. Und mit ihnen kommen Fragen – leise zuerst, fast scheu. Fragen, auf die man keine schnellen Antworten findet.
Warum bleibt ein Land arm, obwohl so viel Öl gefördert wird? Warum erreicht dieser Reichtum die Menschen kaum – oder gar nicht?
Vielleicht beginnt ein Verständnis dort, wo man aufhört, nur auf Zahlen zu schauen, und anfängt, Strukturen zu betrachten. Hinter Fassaden, hinter Versprechen, hinter großen Projekten. Nehmen wir das Beispiel der Republik Kongo, das auf unserer Reise so augenscheinlich war. Um zu begreifen, warum Öl den Alltag der Menschen nicht trägt, muss man den Blick auf den Aufbau der Macht richten.
Formell ist es eine Republik. In der Realität jedoch eine stark zentralisierte Herrschaft. Das Machtzentrum ist der Präsident. Denis Sassou-Nguesso regierte von 1979 bis 1992 – und erneut seit 1997 bis heute. Mit Unterbrechung sind das mehr als 35 Jahre. Eine Zeitspanne, in der sich Macht verfestigt, Systeme ineinandergreifen und Alternativen kaum mehr gehört werden
Unterwegs sehen wir Investitionen: Straßen, Gebäude, Baustellen. Zeichen von Entwicklung auf den ersten Blick. Doch beim Näherkommen fällt etwas auf: Vieles bleibt unvollendet. Straßen verlieren sich im Nichts. Gebäude wirken wie angehaltene Gedanken. Infrastruktur scheint begonnen, aber nie wirklich zu Ende gedacht. Es entsteht der Eindruck, dass das Fertigwerden nicht im Zentrum steht – vielleicht sogar stört. Als wäre das Provisorium stabiler als die Lösung.
Ob dahinter ein System steckt? Vielleicht. Denn Unfertiges bindet. Es hält abhängig. Es erzeugt Dankbarkeit für Kleines und verhindert große Forderungen.
Unsere Reiseberichte sollen nicht urteilen. Wir möchten keine Länder anklagen, keine Regierungsformen verurteilen. Uns geht es um das Verstehen. Und dazu gehört auch der Blick nach außen: Europäische Ölkonzerne, internationale Bergbauunternehmen, große Investitionen aus China. Sie alle bewegen sich seit Jahrzehnten sicher in solchen Strukturen. Sie passen sich an. Sie nutzen, was vorhanden ist, und profitieren von Verhältnissen, die für viele Menschen Stillstand bedeuten.
Am Ende bleibt eine Erkenntnis, die sich nicht in Zahlen fassen lässt: Öl allein macht kein Land reich. Reichtum entsteht dort, wo Macht geteilt wird, wo Strukturen tragen und wo Ressourcen mehr sind als nur ein Licht am Horizont.
Und während die Fackeln weiter brennen und das Meer orange färben, bleibt für uns diese leise Frage im Raum stehen – nicht als Anklage, sondern als Einladung, genauer hinzuschauen.
So geht es weiter Richtung Grenze, in den „anderen“ Kongo. In ein Land, das sich Demokratische Republik Kongo nennt. Ein Name, der Hoffnung trägt – und zugleich eine schwere Geschichte. Bevor die Europäer kamen, war dieses Gebiet kein Niemandsland. Es war ein Raum mit eigenen Ordnungen. Königreiche wie das Kongo-Reich, Luba und Lunda prägten das Leben. Handel und Handwerk verbanden Regionen, Wege führten bis an den Atlantik. Macht war organisiert, Gesellschaften funktionierten. Nicht perfekt, aber eigenständig – ohne europäischen Einfluss.
Der Wendepunkt kam mit Europa. 1885 wurde dieses riesige Land zum Privatbesitz eines einzelnen Mannes: Leopold II., König von Belgien. Er nannte es den Kongo-Freistaat. Ein Name, der Freiheit versprach – und das Gegenteil bedeutete. Die Realität war brutal: Zwangsarbeit, Terror, Gewalt. Millionen Menschen starben. Rohstoffe wie Kautschuk und Elfenbein wurden herausgerissen, nicht gefördert. Hände wurden abgehackt, Dörfer ausgelöscht, Leben zerbrochen. Kaum eine andere Kolonie Europas hat eine so extreme Form der Ausbeutung erlebt. Es ging nicht um Aufbau, nicht um Zukunft. Es ging um Gewinn – schnell, rücksichtslos, um jeden Preis.
Diese Zeit hinterließ tiefe Spuren. Nicht nur in Archiven, sondern in Strukturen, im Misstrauen, im Verhältnis zum Staat. Was folgte, war kein sanfter Übergang, sondern eine Aneinanderreihung von Brüchen: Kolonialverwaltung ohne Vorbereitung, eine Unabhängigkeit ohne Fundament, Machtkämpfe statt Stabilität. Der Mord an der Hoffnung, noch bevor sie Wurzeln schlagen konnte.
Wenn wir uns heute der Grenze nähern, tragen wir dieses Wissen leise mit uns. Nicht als Urteil, sondern als Hintergrundrauschen. Die Schlagbäume, die Stempel, das Warten.
Es ist Samstag, der 31. Januar. Unser Visum für die Demokratische Republik Kongo – das wohl neben jenem für Nigeria am meisten Geduld erfordert und das Wissen voraussetzt, wo und wie man es überhaupt bekommt – ist erst ab dem 1. Februar gültig. Ein Datum, das Hoffnung trägt – und zugleich Geduld verlangt. Der 1. Februar fällt auf einen Sonntag. Und sonntags bleiben die Grenzen geschlossen.
So werden aus einem Tag Wartezeit plötzlich zwei. Nicht durch Bürokratie allein, sondern durch den Rhythmus dieses Landes. Regeln, die existieren, aber Zeit brauchen. Gesetze, die gelten – nur nicht am Sonntag.
So sitzen wir hier, in der katholischen Mission von Cabinda. Ein Ort des Innehaltens. Still genug, um die eigenen Gedanken zu hören. Die Mauern erzählen von einer Zeit, die älter ist als Öl und Verträge. Die Mission war schon da, bevor das Meer nachts zu brennen begann. Sie brachte Schulen, Pflege, Schutz – und bewegte sich doch immer im Schatten der Macht.
Während draußen die Gasfackeln den Himmel färben, ist es hier ruhig. Kein Drängen, kein Weiter. Nur das Wissen, dass Bewegung manchmal erst möglich wird, wenn man stillsteht.
Morgen ist Sonntag. Übermorgen Montag. Dann wird sich der Schlagbaum heben. Bis dahin bleiben wir hier. Zwischen Glockenklang und dem fernen Licht auf dem Meer.